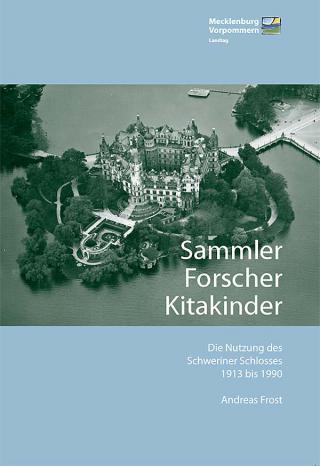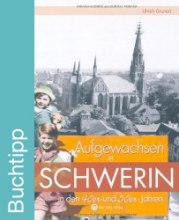Leuchtende Organe - Das Hygiene-Museum im Schweriner Schloss
Als besonders erwähnenswert befand „Das Freie Wort“ einen großen Schaukasten mit natürlichen Präparaten, „die nach einem Verfahren des Professors Dr. Werner Spalteholz durchsichtig gemacht worden sind“. Spalteholz hatte seine berühmten Schaustücke eines „gläsernen Menschen“ bereits 1911 zur Eröffnung des Dresdener Hygienemuseums
angefertigt. Nun „leuchteten“ auch im Schloss mittwochs und sonntags Gefäßsysteme und Organe für den Betrachter.
Die gesundheitliche Aufklärung hatte sich der Landesausschuss für hygienische Volksbelehrung vorgenommen. In der Ausstellung waren drei Räume dem gesunden Menschen gewidmet und drei dem kranken. Während der erste Teil sich der natürlichen menschlichen Entwicklung widmete, belehrten Schautafeln in einem weiteren über eine gesunde Ernährung. Die Bestandteile von Milch und Roggenbrot
wurden veranschaulicht. Auch Hinweise zu „Sport und Leibesübungen“ galten damals bereits als notwendig. In den drei hinteren Räumen demonstrierte die Ausstellung mit täuschend
echt aussehenden Modellen, was einem Arbeiter passieren kann, wenn er sich mit Starkstrom, Blei oder Kalk verätzt oder zuviel Kohlenstaub einatmet. Auch dem Alkohol wurde bildhaft der Kampf angesagt. Der letzte Raum war den Geschlechtskrankheiten gewidmet. Er konnte leicht umgangen werden, wenn ein Lehrer dieses Thema seinen Schülern bei einer Führung nicht meinte zumuten zu können, wie ein Rundschreiben des Ministeriums für Unterricht an alle höheren Lehranstalten betonte.
Seit 1927 hatte der Landesausschuss für hygienische Volksbelehrung sich bemüht, das Hygienemuseum auf die Beine zu stellen. Aber es dauerte seine Zeit, die Landesversicherungsanstalt als Geldgeber zu finden. Während das Dresdener Hygienemuseum von den Nationalsozialisten nach 1933 in den Dienst ihrer „Rassenlehre“ gestellt wurde, wurde das Schweriner Pendant Anfang 1935 erst einmal geschlossen. Dabei hatte es hochrangige Unterstützer im NS-Staat. Zu seinen Gründern gehörte der damalige Leiter des Landesgesundheitsamtes Hans Reiter, der auch „Sozialhygiene“ an der Universität Rostock lehrte. Der Verfechter einer „erbbiologischen Hygiene“ war seit 1932 NSDAP-Abgeordneter im Schweriner Landtag. Ein Jahr später beförderten die Nazis ihn zum Leiter des Reichsgesundheitsamtes.
Mecklenburgs Reichsstatthalter Friedrich Hildebrandt hielt allerdings ein Bauernmuseum im Schloss für wichtiger als die „Volksgesundheit“. Deshalb musste das Hygienemuseum zwischenzeitlich den vom Heimatforscher Richard Wossidlo gesammelten Trachten weichen. Ende 1939 wurde das Hygienemuseum endgültig geschlossen. Das Kunstmuseum
bedankte sich bei der Leitung, dass es in den Räumen des Hygienemuseums Gemälde in Sicherheit bringen konnte. Aus Angst vor den brennbaren Flüssigkeiten mussten die in Spiritus eingelegten Präparate und die Wachsmodelle des Hygienemuseums in einem Raum zusammengestellt werden.