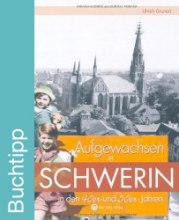„Und dann kam mein Vater!“ - Flucht nach Schwerin

Puschkinstraße 32
Als ich Kind war, sind wir alle zwei Jahre umgezogen. Mein Vater war damals verantwortlich für den Aufbau des deutschen Telefonnetzes. Zuletzt lebten wir im Sudetenland. Das war der Schlusspunkt.
Von dort sind wir 1945 zu Fuß zurück nach Schwerin gelaufen. Elf Wochen. Meine Mutter mit uns drei Kindern. Meinen Vater hatten wir in den Wirren des Kriegsendes verloren. Um uns vor den einmarschierenden Russen in Sicherheit zu bringen, hatte er uns ins Gebirge geschickt. Er selber blieb in der Stadt zurück. Wider Erwarten kamen die Russen dann aber zuerst ins Gebirge. Mit einem Wehrmachtswagen, den meine Mutter angehalten hatte, machten wir uns auf den Weg zurück in die Stadt. Aber als wir dort ankamen, war mein Vater nicht mehr da. Alle waren weg. Man hatte alle Deutschen ausgewiesen. Wir wussten nicht, ob er noch lebt, und er wusste nicht, ob wir noch leben. Im Juli war das.
Wir sind dann zu Fuß durchs Glatzer Bergland. Wir sind immer auf der Autobahn gegangen, weil es da sicherer war. Klar, da fuhren schon manchmal Autos, aber bei den Landwegen wusste man ja nicht, was da los war.
Ich war die Älteste von uns dreien, das kleinste Geschwisterchen war erst ein halbes Jahr alt. Ich hab‘s die ganze Zeit im Kinderwagen geschoben, in so einem großen Kinderwagen mit kleinen Rädern dran. Und ich hatte unbedingt meine Geige mitnehmen wollen. Damals bekam ich schon Geigenunterricht. Die hab ich dann getragen. Irgendwann kam der Moment, wo ich nicht mehr weiterkonnte. Als meine Mutter merkte, dass ich fehlte, kam sie zurück und sagte: „Du musst weitergehen, das hilft nicht!“ Da bin ich schließlich weitergegangen. Die Geige hab ich dort im Graben liegen lassen.
Ich hatte immer furchtbare Angst, dass die Russen meine Mutter wegfangen und dass ich dann alleine für die kleinen Kinder sorgen sollte. Die haben ja auch Frauen vergewaltigt. Und wenn jemand eine Uhr oder Schmuck versteckt hielt, dann waren sie sehr brutal. Aber wir haben auch nette Russen getroffen. Die haben uns was zu trinken gegeben und Leibniz-Kekse. Die waren ja immer kinderlieb.
In den Bergen waren immer noch Partisanengruppen. Die haben geschossen. Einmal flogen in einer Schlucht die Kugeln über uns rüber. Da haben wir uns an die Seite geworfen und uns ist nichts passiert. Nachts mussten wir oft im Wald schlafen oder wir sind in ein Dorf gegangen und haben gefragt, ob wir dort übernachten können. Dann durften wir auch mal in der Scheune schlafen und bekamen ein bisschen was zu essen.
Dieser Fußmarsch war natürlich eine ungeheuerliche Anstrengung für uns. Und ich hatte oftmals große Angst. Aber manches war für uns Kinder auch mehr wie ein großes Abenteuer. Im Wald zu schlafen zum Beispiel. Als Kind empfindet man das alles als nicht so schlimm. Wir waren trotzdem fröhlich und lustig und alles.
Dann sind wir in Cottbus angekommen. Wir haben uns gefreut: „Nun können wir endlich mit dem Zug fahren!“ Aber die hatten ja beim Rückzug die ganzen Brücken gesprengt – da fuhr kein Zug. Da waren es noch 99 Kilometer bis Berlin. Also sind wir wieder zu Fuß gegangen. In Berlin haben wir eine Nacht am Lehrter Bahnhof in den Trümmern geschlafen. Am nächsten Tag konnten wir einen Zug nehmen bis nach Grabow. Und von Grabow sind wir wieder gelaufen bis Neustadt-Glewe, dort verlief die Sektorengrenze. Und über die kamen wir nicht rüber. Schwerin war damals zuerst von den Amerikanern besetzt worden, dann übernahmen es die Engländer und nun war grad der Russe gekommen. Den ganzen August bis zum Ende des Sommers verbrachten wir in einem kleinen Dorf bei Neustadt-Glewe. Endlich bekamen wir einen Passierschein und konnten weiter. Wieder zu Fuß.
Unser Weg führte über den Dreesch in die Stadt hinein. Beim „Ortkrug“ haben wir noch einmal übernachtet. Am nächsten Tag erreichten wir dann gegen Mittag die Innenstadt. Ich werde nie vergessen, wie wir auf dieses Haus in der Friedrichstraße zugingen! Heute ist dort ein Designer-Laden oder so etwas drin, schöne Sachen gibt‘s da. Im oberen Stockwerk wohnte ein Freund meines Vaters, von uns Kindern Onkel Albert genannt. Wir hofften, dort etwas über meinen Vater zu erfahren, vielleicht sogar Unterschlupf zu finden.
Auf unser Klingeln guckte Alberts Frau oben raus, ganz in Schwarz gekleidet. „Ach“, hat meine Mutter gesagt, „jetzt ist er gestorben, der Onkel Albert!“ Wie sich herausstellte, betrauerte die Frau aber ihren Vater. Der war beim Bombenangriff ums Leben gekommen, hier am Straßenbahn-Depot. Onkel Albert lebte! Und man wusste, wo unser Vater war! An diesem Mittag, als wir ankamen, war er grad bei der Arbeit. Er arbeitete damals schon wieder bei der Post. Ich weiß gar nicht wie, aber die Frau ließ ihn rufen. Telefone gab es da ja eigentlich noch gar nicht. Man konnte ja auch nicht einmal von unterwegs schreiben. Man wusste ja gar nichts. Und dann kam mein Vater!
Buchtipp:
45 Meter über Normalnull - Schwerin. Eine erinnerte Stadt. Herausgeber: Kulturfiliale GbR, Kontakt und Bestellung: kulturfiliale@kulturfiliale-hannover.de
Das Projekt:
„Spielstätte Stadt hat sich auf die Fahnen geschrieben, zwei Jahre lang den Alltag, die Geschichten und die Sehnsüchte Schwerins zu erforschen", so Nils Zapfe, neben Frauke Löffel der Initiator des Projekts. Eine erinnerte Stadt, das sind mehr als 40 Geschichten, die gesammelt und aufgeschrieben werden konnten. Einige davon sind am Montag am Pfaffenteich zu hören, drei davon lesen Sie in unserem Magazin.
Teil 1: Am Strand 31