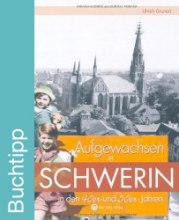14 Fotos vom Schweriner Tafelsilber
Wir stehen im Hauptturm an der Seeseite. Das Gewölbe riecht noch nach frischer Farbe. Unter uns liegt der Eiskeller. Über uns das Blumenzimmer. Einst spielten hier die Kinder des Großherzogs. Über eine Fenstertreppe konnten sie schnell in den Burgarten huschen. „Pläne, daraus die Silberkammer zu machen, gab es schon früher“, sagt Ralf Weingart, Leiter des Schlossmuseums. Skizzen dazu auch. Jahreszahlen nicht.
Man könnte eine Silberkammer auch begehbaren Küchenschrank nennen. Hier standen silberne Terrinen, Bestecke, Becher, Teller, Kannen, Schalen, Zuckerdosen, Salzstreuer, Tafelaufsätze und Leuchter. Manche waren auch vergoldet. Kostbare Kerzen, Servietten, Tischtücher hatten darin ebenfalls Platz.
Den Überblick über das Tafelsilber behielt der Tafeldecker. Er deckte die Tische ein und ab, führte Listen über das Inventar und wog das Geschirr regelmäßig. Zur Kontrolle, dass nicht jemand heimlich etwas aus dem Silber herausgenommen hat. „Dafür erhielt er 1901 zwischen 1900 und 2100 Mark“, sagt Ralf Weingart. Im Jahr. Dann gab es noch den Silberdiener. Er musste täglich das Silber putzen, das Geschirr zu den Serviertischen und zur Abwäsche bringen. Lohn, Stand 1901: 1000 bis 1200 Mark im Jahr. Das letzte Glied in der Silberkette waren die Silberwäscherinnen. Für 200 Mark Jahreslohn wuschen sie das Geschirr ab.

Die Silberkammer zu sanieren, hat viele Jahre gedauert und 1,27 Millionen Euro gekostet. Ein Großteil des Geldes kam aus einem Fördertopf des Bundes. Jetzt ist alles fertig. Die Farbe trocken, das Tafelsilber an seinem Platz. Die Besucher können kommen. Am Samstag, zur Eröffnung, haben sie den ganzen Tag freien Eintritt.